SEHENSWÜRDIGKEITEN
HÄUSER AUF DEM MARKPLATZ UND AN DER FUSSGÄNGERZONE
HAUS VON OSWALD HAFENRICHTER
ZURÜCK ZUR AUFLISTUNG
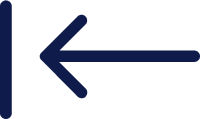
Haus von Oswald Hafenrichter
Für die Öffentlichkeit lediglich zu den Betriebszeiten der hier angesiedelten Betriebe geöffnet.
Das Haus C.N. 9 gehörte zu den drei Häusern, die den Abschluss des Egerer Marktplatzes an der Stelle des Rossmarktes bildeten. Der älteste bekannte Besitzer war Johann Walburger, der das Gebäude in den Jahren 1531–1545 bewohnte. An der Verwaltung der Stadt beteiligte sich von den Hausbesitzern Paul Trage am aktivsten, der zwischen 1612 und 1629 im außeren Stadtrat saß und in den Jahren 1630–1632 ein Mitglied des Stadtgerichts war. Bis 1867 bewahrte sich das Bürgerhaus mit einem Fachwerkgiebel seinen gotischen Charakter. Von der nördlichen Stirnseite betrat man das Haus durch ein Spitzbogenportal ins Maßhaus; dort neigte sich das Kreuzgewölbe zur mittigen Säule. Seine mittelalterliche Gründung verriet auch die tiefe Parzelle, die bis an die Wälle reichte. Im Jahre 1867 wurde das Haus zum größten Teil abgerissen und dann nach dem Projekt von Adam Haberzettl umgebaut. Der Baumeister griff erneut zu seinem beliebtesten Stil, der sich an die Gotik anlehnte, angereichert mit einer Reihe an Renaissance-Elementen (insbesondere der Hauptgesims). Die umfangreiche Stirnseite rhythmisierte Haberzettl durch Risalite mit Halbsäulen, die zwei Etagen verbanden. Diese krönte er mit stufiger Attika. Das Objekt wurde im Rahmen des Umbaus in zwei Hausnummern aufgeteilt, wobei die C.N. 8 an der Ecke der Šlikova Straße und der Svobody Straße von dem Ehepaar Adam Kreuzinger und Theresia Kreuzinger gebaut wurde. Im Parterre des Hauses befanden sich zahlreiche kleinere Geschäfte mit Galanterie- und Kurzwaren, mit Bekleidung und Schuhwerk, eine Wäscherei und auch ein Spielzeuggeschäft mit überwiegend Nürnberger Spielwaren (Karl Weichesmüller). In den 20er Jahren des 20. Jh. hatte hier Anton Böhringer seine bekannte und hochwertige Buchhandlung, und Hans Böhringer betrieb dort ein Antiquariat. Das Gebäude, das praktisch einen Block bildete, wurde im Jahre 1939 teilweise abgerissen (C.N. 8), um an dieser Stelle das moderne Haus von Rudolf Stanky entstehen zu lassen. Nach dem Krieg befanden sich im Erdgeschoss des Hauses ein Schmuck- und Uhrengeschäft und eine Buchhandlung. Que procedit, s. 45-49.
Autoren der Texte:
Zbyněk Černý – Karel Halla – Hana Knetlová, Übersetzung Ivana Betram
Literatur:
Zbyněk Černý – Karel Halla – Hana Knetlová, Que procedit. Historie pěší zóny v Chebu / Geschichte der Fussgängerzone in Eger, Město Cheb 2010, s. 45-49
Eigentümer:
1531–1545 Johann Walburger
1546–1560 Witwe von Johann Walburger
1561–1565 Franz Brunner
1566–1577 Clemens Ludwig
1578–1590 Peter Stobitzer
1591–1595 Witwe von Peter Stobitzer
1596 Peter Wilhelm
1597–1610 Witwe von Peter Wilhelm
1611–1631 Paul Trager
1632–1637 Witwe von Paul Trager
1638–1657 Paul Tragers Vormund
1658–1679 Georg Adam Eberhard
1680–1695 Helene Eberhard
1696–1739 Helene Eberhards Erben
1740–1758 Maria Rosina Haintzmann
1868–1893 Oswald und Maria Hafenrichter
1893–1934 Eduard und Maria Lederer und ihre Erben
1934–1946 Hermine Fischer und Emma Hermine Kaessmann
1946–1949 Nationalverwaltung
1949 Stadt Eger
Projekt:
Adam Haberzettl
Mehr anzeigen


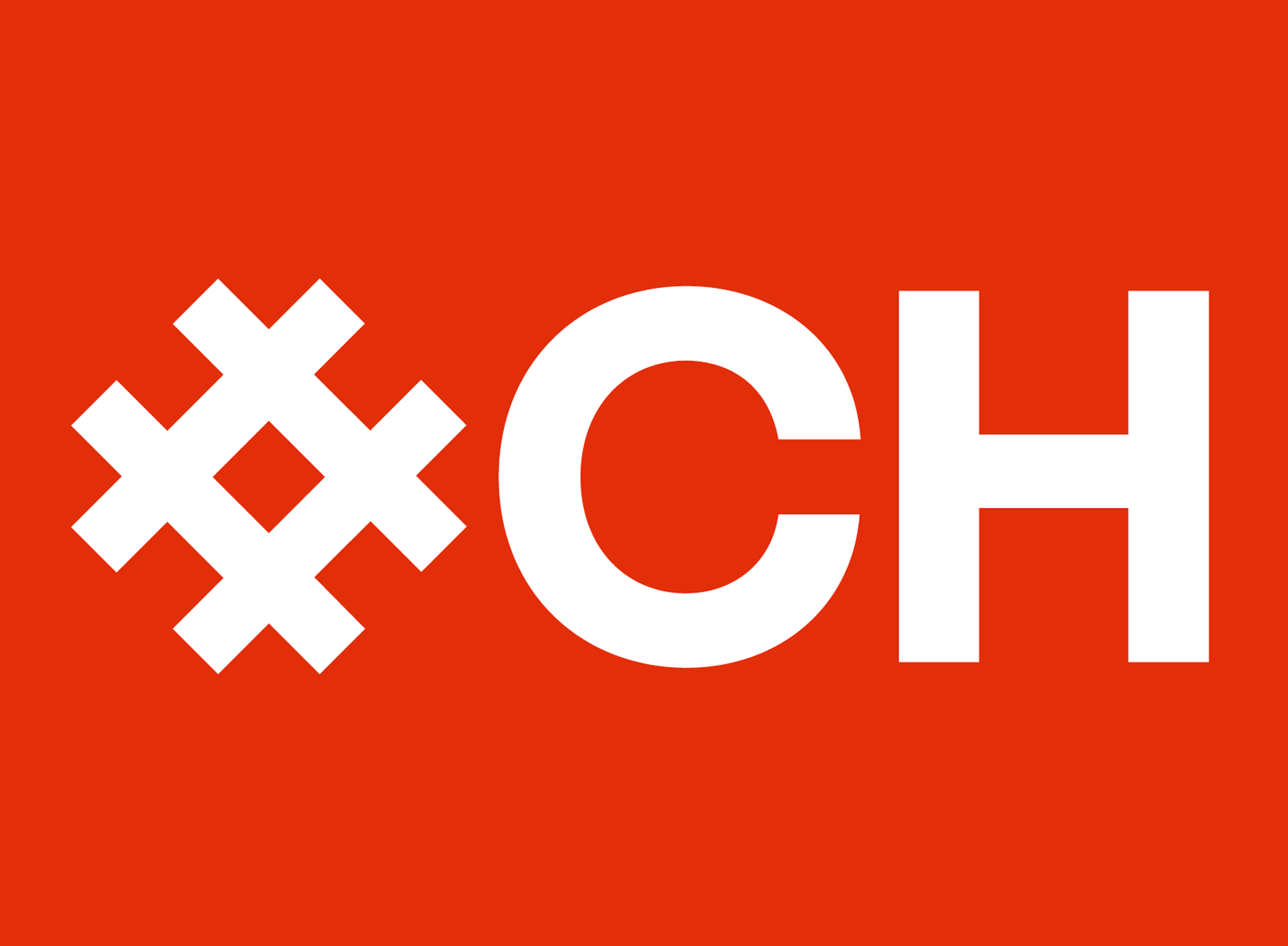 OFFIZIELLE WEBSITE DER STADT CHEB
OFFIZIELLE WEBSITE DER STADT CHEB
 TOURISTISCHES INFOZENTRUM
TOURISTISCHES INFOZENTRUM
 HISTORISCHE EGER STIFTUNG
HISTORISCHE EGER STIFTUNG

 KULTURZENTRUM SVOBODA
KULTURZENTRUM SVOBODA
 WESTTSCHECHISCHES THEATER CHEB
WESTTSCHECHISCHES THEATER CHEB
 STADTBIBLIOTHEK IN CHEBU
STADTBIBLIOTHEK IN CHEBU

