SEHENSWÜRDIGKEITEN
HÄUSER AUF DEM MARKPLATZ UND AN DER FUSSGÄNGERZONE
DAS STÖCKL
ZURÜCK ZUR AUFLISTUNG
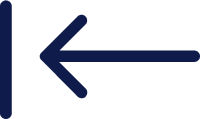
Das Stöckl
Für die Öffentlichkeit lediglich zu den Betriebszeiten der hier angesiedelten Betriebe geöffnet.
Zum Wahrzeichen des Egerer Marktplatzes wurde ein mittelalterlicher Häuserblock, das „Stöckl“ genannt wird. Es ist ein wunderlicher, durch das schmale Kramergäßchen geteilter Komplex von elf zusammengelegten Häusern. Die im 13. Jahrhundert hier stehenden hölzernen Krämerbuden und Fleischbänke wuchsen im Laufe der Zeit zu mehreren Steinhäusern mit Fachwerkobergeschoßen zusammen.
Nach einer Zeichnung aus dem Jahre 1472 blieb die Grundanlage bis heute erhalten, abgerissen wurde 1809 nur eine dritte, im westlichen Teil stehende Häuserreihe. Der Abriss der restlichen Häuser drohte im Verlauf der Rekonstruktion der Stadt in den Jahren 1956-1962, als der schreckliche Zustand des Stöckls von Erwägungen eines Abbruchs und eines modernen Neubaus bis zur Erhaltung in der Form einer Skulptur aus Beton mit den bloßen Außenmauern führte. Ende des Jahres 1960 begann man doch mit den Rettungsarbeiten und das Stöckl wurde erhalten, auch wenn es in Wirklichkeit nur noch aus den dekorativen Außenwänden besteht und innen völlig entkernt und verändert ist.
Zum Wahrzeichen des Egerer Marktplatzes wurde ein mittelalterlicher Häuserblock, das „Stöckl“ genannt wird. Es ist ein wunderlicher, durch das schmale Kramergäßchen geteilter Komplex von elf zusammengelegten Häusern. Die im 13. Jahrhundert hier stehenden hölzernen Krämerbuden und Fleischbänke wuchsen im Laufe der Zeit zu mehreren Steinhäusern mit Fachwerkobergeschoßen zusammen.
Nach einer Zeichnung aus dem Jahre 1472 blieb die Grundanlage bis heute erhalten, abgerissen wurde 1809 nur eine dritte, im westlichen Teil stehende Häuserreihe. Der Abriss der restlichen Häuser drohte im Verlauf der Rekonstruktion der Stadt in den Jahren 1956-1962, als der schreckliche Zustand des Stöckls von Erwägungen eines Abbruchs und eines modernen Neubaus bis zur Erhaltung in der Form einer Skulptur aus Beton mit den bloßen Außenmauern führte. Ende des Jahres 1960 begann man doch mit den Rettungsarbeiten und das Stöckl wurde erhalten, auch wenn es in Wirklichkeit nur noch aus den dekorativen Außenwänden besteht und innen völlig entkernt und verändert ist.
(bh)
Mehr anzeigen


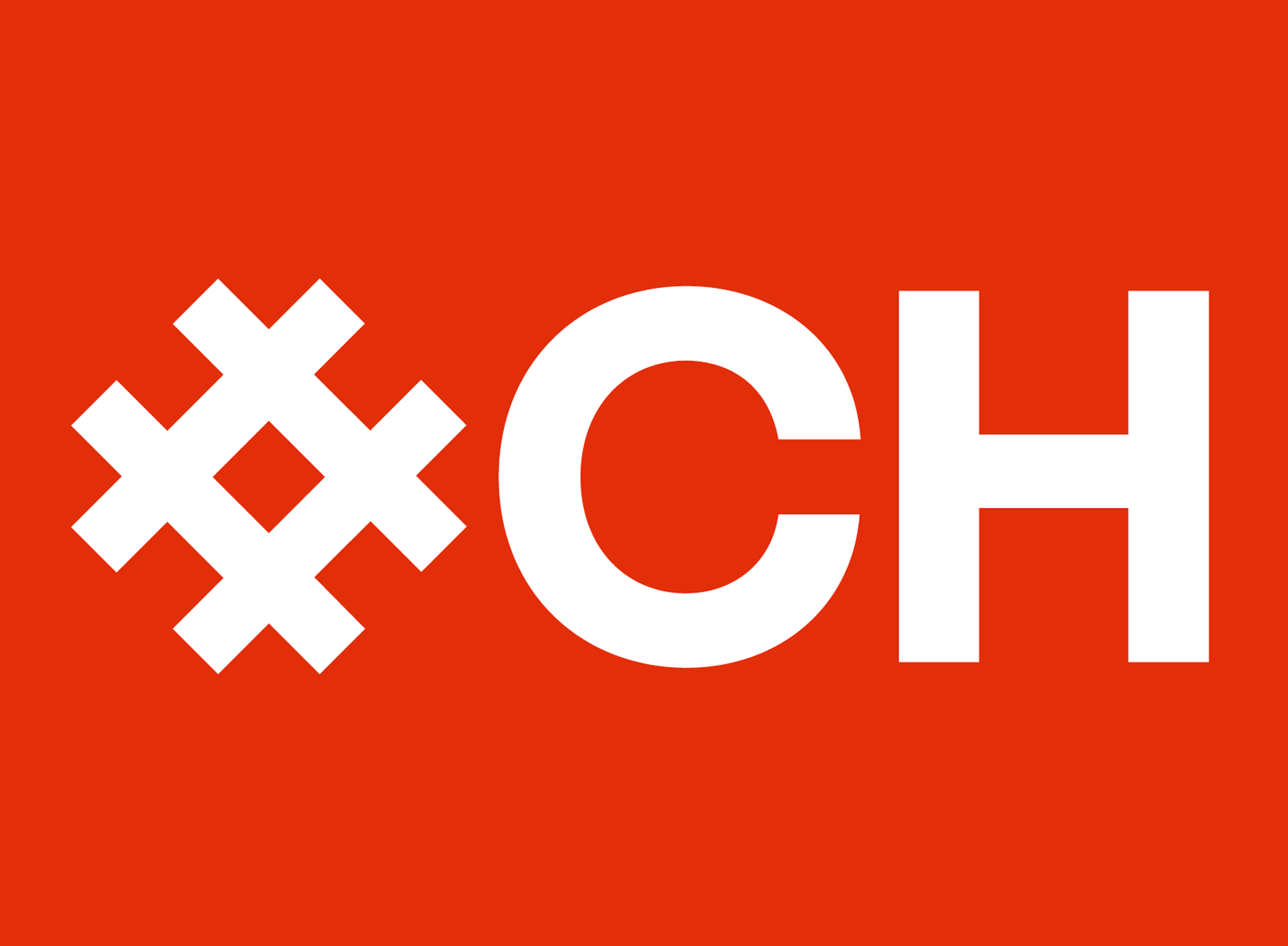 OFFIZIELLE WEBSITE DER STADT CHEB
OFFIZIELLE WEBSITE DER STADT CHEB
 TOURISTISCHES INFOZENTRUM
TOURISTISCHES INFOZENTRUM
 HISTORISCHE EGER STIFTUNG
HISTORISCHE EGER STIFTUNG

 KULTURZENTRUM SVOBODA
KULTURZENTRUM SVOBODA
 WESTTSCHECHISCHES THEATER CHEB
WESTTSCHECHISCHES THEATER CHEB
 STADTBIBLIOTHEK IN CHEBU
STADTBIBLIOTHEK IN CHEBU

