SEHENSWÜRDIGKEITEN
HÄUSER AUF DEM MARKPLATZ UND AN DER FUSSGÄNGERZONE
DAS GABLERHAUS
ZURÜCK ZUR AUFLISTUNG
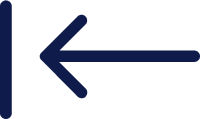
Das Gablerhaus
Für die Öffentlichkeit lediglich zu den Betriebszeiten der hier angesiedelten Betriebe geöffnet.
Das Haus mit einer reich gegliederten und gezierten Fassade im Stil des Rokoko gehört zu den wertvollsten Ergebnissen der spätbarocken Umbauten im 18. Jahrhundert. Dieses im Kern spätgotische Haus kauften im Jahre 1657 die Jesuiten, sie wollten es mit den Nachbarhäusern abreißen und durch ein Konventgebäude ersetzen. Zum Bau kam es nicht und aus dieser Zeit blieb über dem Portal das Madonnenrelief mit einem Chronogramm (1662) erhalten. Die feine Rokokofassade aus der Mitte des 18. Jahrhunderts mit reichen Rocailleornamenten und Allegorien der Vier Jahreszeiten blieb bis heute erhalten. Eine Bemalung mit Rokokoornamentik finden wir auch im Inneren des ersten Stockwerks, im zweiten Stockwerk wurde ein spätgotisches Wandfresko entdeckt. Ende des 18. und am Beginn des 19. Jahrhunderts gehörte das Haus dem Magistratsrat Anton Gabler. Seine reiche Bibliothek und eine umfangreiche Musikaliensammlung machten dieses Haus damals zum Kultursalon der Stadt.
(bh)
Mehr anzeigen

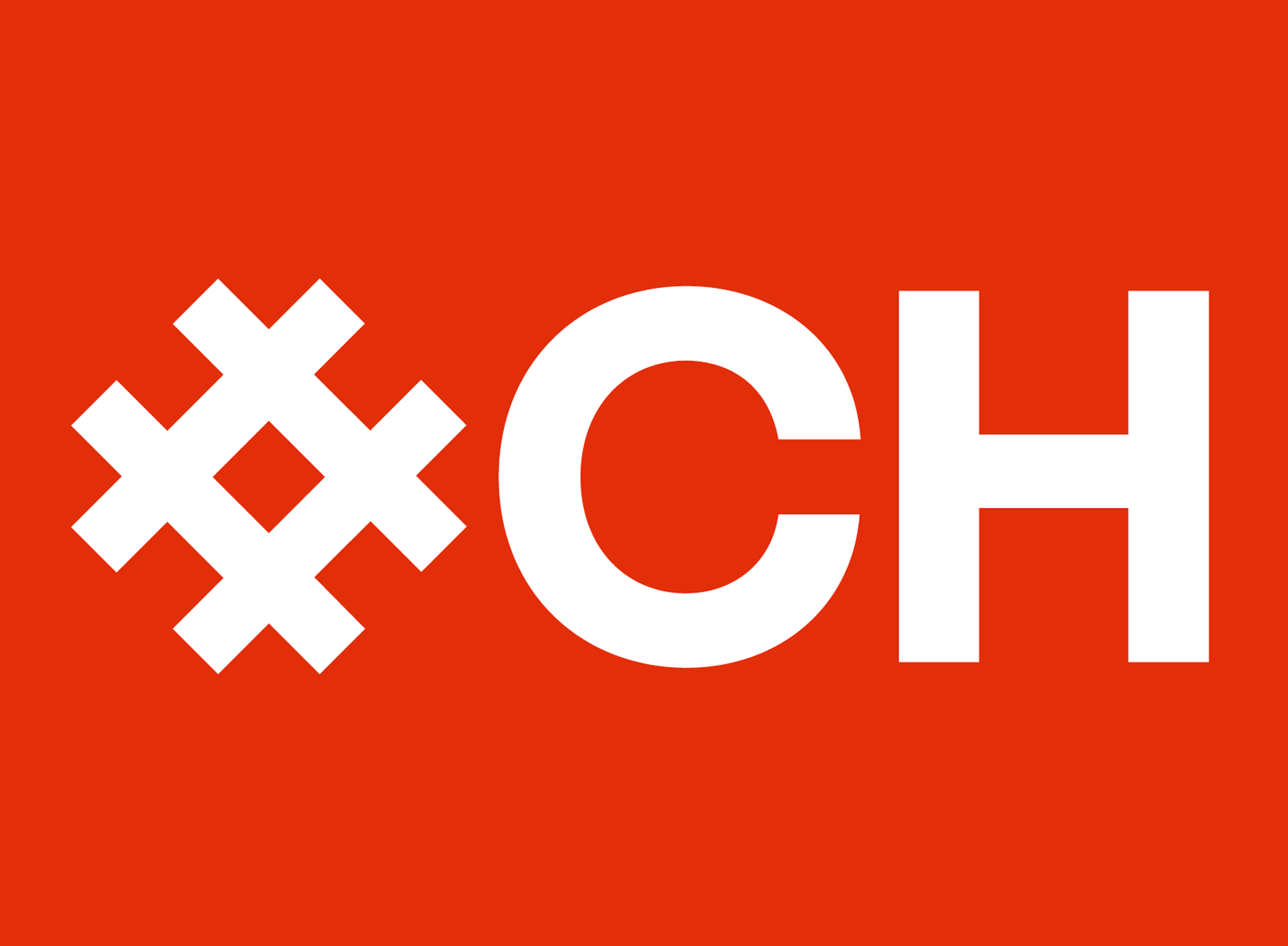 OFFIZIELLE WEBSITE DER STADT CHEB
OFFIZIELLE WEBSITE DER STADT CHEB
 TOURISTISCHES INFOZENTRUM
TOURISTISCHES INFOZENTRUM
 HISTORISCHE EGER STIFTUNG
HISTORISCHE EGER STIFTUNG

 KULTURZENTRUM SVOBODA
KULTURZENTRUM SVOBODA
 WESTTSCHECHISCHES THEATER CHEB
WESTTSCHECHISCHES THEATER CHEB
 STADTBIBLIOTHEK IN CHEBU
STADTBIBLIOTHEK IN CHEBU


