Prökl 1877
Das Junckher-Pachhelblische-Haus
Das jetzige Stadthaus (Wallenstein´s Todeshaus) Nr. 492 auf dem untern nördlichen Theile des Rings, zwischen diesem und dem Kirchplatze, neben der dermaligen „alten Apotheke“, hinter der Stöcklgruppe. Das alte, vorher dort gestandene Haus gehörte schon 1531 der ausgestorbenen rathsherrlichen Familie Gräffen, 1600 – 1603 dem Johann Flenz, 1604 – 11 dem Reinhold Holdorf, der das alte Vorderhaus abnahm und das jetzige schöne Haus aufführte, es aber nur 8 Jahre besaß und über dem Eingang die Wappen der Gräffen und Holdorf mit der Jahreszahl 1600 in Stein gehauen anbrachte. Es gehörte dann 1602-16 dem reichen Christoph Hammer, 1617-18 der Barbara Flenz.
Wie unter Post 17 erwähnt, kauften es die Eheleute, Bürgermeister Wolfgang Adam Pachhelbel und Ursula, geb. v. Junckher, 1619 an; er starb bereits 1620 und die Witwe Ursula übergab, wie gesehen, das ältere Stammhaus Nr. 3 dem älteren Sohne Wolf Adam II 1625, und dieses neu angekaufte Haus dem jüngeren Sohne Alexander, als dieser seine Cousine Magdalena, die Tochter seiner Mutter Bruders, des Bürgermeisters Adam Junckher von Oberkunreut, 1621 geheirathet. Dieser Alexander v. Pachhelbel wurde 1633 von dem kaiserlichen Regimente Adelshof nebst 3 Wunsiedler Rathsgliedern als Geisel nach Eger gebracht und hier 12 Wochen gefangen gehalten, bis man sie mit 4000 Thalern auslöste; er starb noch 1633 zu Wunsiedl, kinderlos, nur mit Hinterlassung der Witwe Magdalena, gebornen v. Junckher.
Diese allein besaß nun das Haus 492, das die Stadt sequestrirt hatte, als Eigenthümerin, als Wallenstein auf seinem Todesgange hier am 24. Februar 1634 einkehrte, den folgenden Tag dort verweilte und dann in nächster Nacht darin seinen Tod fand; es blieb in ihrem Eigenthum bis zu ihrem Tod 1640, dann in dem ihrer Erben, die es erst 1642 veräußerten.
Hiernach berichtigen sich viele Inkorrektheiten, die sich sogar in allen Spezialgeschichten über die Wallenstein´sche Katastrophe und ihrem Schauplatz (bei Heschenhahn, Murr, Förster, Richter, Janko, Hurter, Ranke) finden. Es ergibt sich, daß damals gar kein Bürgermeister Pachhelbel in Eger existirte, denn der Bürgermeister Wolf Adam Pachhelbel war schon 1629 abgesetzt und exilirt und sein Bruder Alexander ist niemals hier in Eger Bürgermeister gewesen (1634 bereits todt), vielmehr war damals zur Zeit der Wallenstei´schen Ermordung zu Eger neben dem seit 1628 fungirenden katholischen Adam Schmiedl von Seeberg statt dem 1629 vom Kaiser an Stelle des abgesetzten lutherischen Pachhelbel ernannt, des letzteren Mutterbruder der katholische Paul Junckher von Oberkunreut (ehemals Obristlieutenant in Wallenstein´schen Heere, Herr auf Pograth).
Bei der Katastrophe besetzte Oberst von Buttler mit seinem Major Geraldin und den Dragonern die Vorderthür des Hauses nach dem Markte und das hintere Hofthor auf dem Kirchplatze mit 15 Mann; durch die Vorderthüre begab sich Kapitän Deveroux mit 6 Hellebardiren die große Vordertreppe links im Hausflur hinauf, durch den oberen Vorderflur und durch das große mittlere Zimmer in Wallenstein´s Schlafgemach, welches vorne heraus nach dem Markte über dem jetzigen ebenerdigen Doppelfenster neben dem Thore lag und damals auch ein solch´ doppeltes Fenster hatte, nach einer baulichen Veränderung aber nach 1735 vor 1790 nur noch das jetzige ein Fenster behielt. Ebenso hat man Wallenstein´s Leichnam in ein großes Tuch gehüllt, die vordere große noch bestehende Treppe hinab in den Hofflur gebracht und in Leslie´s alter Kutche auf die Burg geführt, dort in die untere Burgskapelle mit den Leichen seiner in der Burg gamordeten Anhänger, der beiden Grafen Terzky und Kinsky, des Marshalls Illo und des Rittmeisters Neumann bis zur Fortschaffung am nächsten Abend gesetzt.
Ein Jahr nach der Katastrophe bezogen am 6. März 1635 die Jesuiten das leerstandene, sequestrierte Haus und kauften es nach dem Tode der Eigenthümerin von deren Erben am 3. März 1642 für 1500 fl. Die Jesuiten, deren Pater-Rektor in dem Mordzimmer wohnte und welche dort auch eine Gespenstergeschichte im Jahre 1638 erlebt haben (Murr, S. 40), bewohnten das Haus 70 Jahre lang, bis sie 1706 ihr eigenes zur Hälfte neugebautes Kollegium bezogen und der Stadt das Haus abtraten.
Von letzterer hat es sofort der damalige Bürgermeister von Eger, Johann Adam Junckher, für 4000 fl. erstanden und gleichfalls immer in dem Mordzimmer amtiert, nachdem das Haus von ihm ohne bauliche Veränderungen renovirt wurde. Das Haus blieb wiederum etwa 30 Jahre bei der Familie von Junckher, die es bei ihrem Verlassen des Egerlandes 1735 an die Stadt Eger für 6100 fl. verkaufte. Seither besitzt es die Stadt Eger.
Erst nach der Zeit des Überganges des Hauses von der Familie von Junckher an die Stadt stammen die in dem verkauften Hause befindlichen kunstvollen eingelegten Möbelstücke, die von Fremden häufig auf Wallenstein zurückgeführt sind während sie dieser spätern Zeit angehören und jedenfalls Kunstprodukte des Egerer Ingenieurs und Kunsttischlers Nikolaus Haberstumpf und Anderer sind, die hier 1719 – 40 wirkten, und von deren Hand auch mehrere kunstvolle Stücke im kaiserlichen Luftschlosse Laxenburg bei Wien sich befinden. Auch die beiden Exekutionsbilder Wallensteins in diesem Hause und seiner Genossen in der Burg, welche in diesem Hause hängen, sind nicht aus der Zeit seiner Katastrophe, sondern erst 102 Jahre nach derselben für den Magistrat, nachdem dieser das Haus eben erworben hatte, 1736 durch den Maler Hofreuter zur Erinnerung an den Vorfall anfertigt. Besser als diese zwei Bilder ist Wallenstein´s wohlgetroffenes Bildniß, angefertigt von einem berühmten Künstler der Zeit seiner letzten Lebensjahre. Auch das ihm vorgetragene Schwert und die Partisane, mit der er durchstochen sein soll, wird gezeigt. (Fremde, welche das Haus besuchen, können dort wohlgelungene Photographien von diesen Abbildungen erhalten).
Die Stadt verwendete das Haus früher als Wohnung für die jedesmaligen Stadtkommandanten, da das einst von ihnen bewohnte Burgschloß verfallen war. Von diesem ließ erst der General von Güldenhoff die lang erhalten gewesen Blutspuren in dem Mordzimmer von den Mauern unterhalb des Fensters abkratzen und überweißen, und der ihm nachgefolgte Kommandant General Stöffling ließ das ganze Zimmer ausmalen und bewohnte es bis zu seinem Tode (1777). Kaiser Josef bewohnte mit seinem Gefolge das Haus bei zweimaliger Anwesenheit (1766-79).
Vom Jahre 1808 anfangend erhielt der damalige Bürgermeister, Abraham Totzauer, den ersten Stock dieses Hauses bis zu seinem Tode (20. November 1848) als Naturalquartier a partem salarii, dann miethete den ersten Stock der Goldarbeiter Reitzner, welcher dort seine Juwelen durch 4 Jahre zum Verkaufe ausbot. Bis dahin hat man immer der Thatsache entsprechend das kleinere Zimmer gegen den Markt als Wallenstein´s Todeszimmer gezeigt, und als Reitzner die Wohnung verlassen mußte, schrieb er mit Diamant in die obere Glastafel des rechtsseitigen innern Fensters dieses kleinen Zimmers: „Adieu, Wallenstein, wir können nicht immer beisammen seyn, 18. November 1849“, welche Inschrift noch heute dort zu sehen ist.
Die Stadtverwaltung ließ nunmehr das Haus als Gemeinde- oder Stadthaus mit Bureaux, Kanzleien und Sitzungssälen einrichten, wobei 1850 das vordere kleine Zimmer gegen den Markt als Bureau des Bürgermeisters, später als Kanzlei des Stadtsekretärs eingerichtet, dagegen für die besuchenden Fremden in das rückwärtige dreifensterige Zimmer des Hinterhauses Wallenstein´s Porträt, das Schwert, die Partisane und die beiden Exekutionsbilder übertragen wurden, deswegen allmälig über die Enzelnheiten des Vorganges eine getrübte Auffassung entstand . Mit dem Jahre 1873 ließ der Stadtrath in dem rückwärtigen dreifensterigen Zimmer ein reichhaltiges Egerländer Museum einrichten. Vergleiche darüber den besonderen Abschnitt dieses Werkes. Über der Eingangshalle rechts ist das Junckherische Wappen angebracht.
(Prökl 1877,498-502)
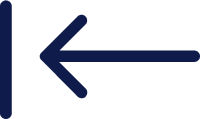

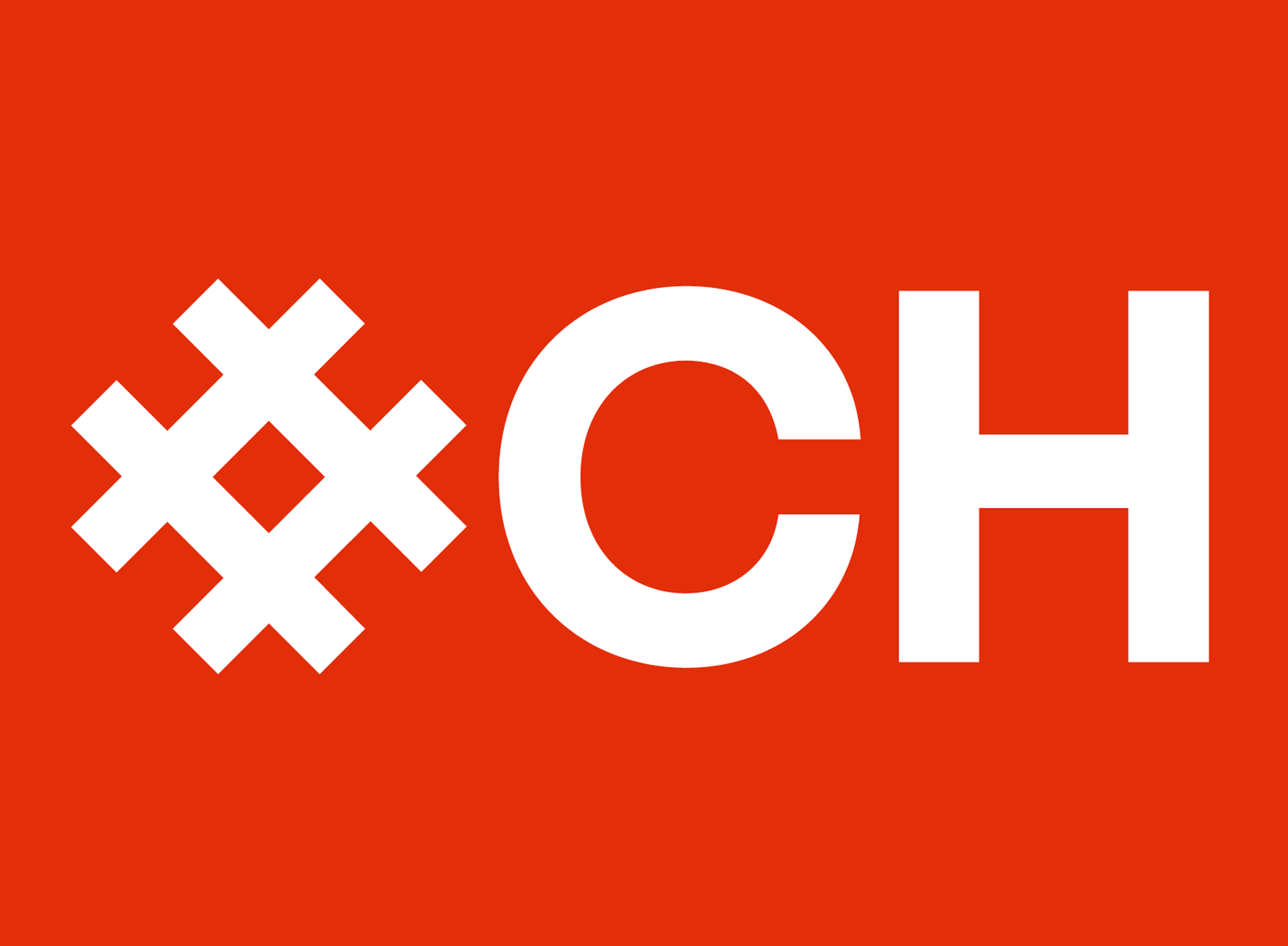 OFFIZIELLE WEBSITE DER STADT CHEB
OFFIZIELLE WEBSITE DER STADT CHEB
 TOURISTISCHES INFOZENTRUM
TOURISTISCHES INFOZENTRUM
 HISTORISCHE EGER STIFTUNG
HISTORISCHE EGER STIFTUNG

 KULTURZENTRUM SVOBODA
KULTURZENTRUM SVOBODA
 WESTTSCHECHISCHES THEATER CHEB
WESTTSCHECHISCHES THEATER CHEB
 STADTBIBLIOTHEK IN CHEBU
STADTBIBLIOTHEK IN CHEBU


